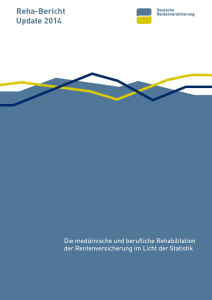Ziel: Darstellung der Häufigkeit von selbstberichtetem diagnostiziertem Burnout-Syndrom und psychiatrische Komorbiditäten.
Methode: Bundesweite Studie, n = 7987. Burnout-Syndrom: selbstberichtete ärztl./psychother. Diagnose. Psychische Störungen: diagnostisches Interview, n = 4483.
Ergebnisse: Prävalenz: Lebenszeit 4,2 %, 12 Monate 1,5 %. Irgendeine psychische Störung: 70,3 % derer mit Burnout-Diagnose. Assoziierte Störungen: somatoforme, affektive, Angststörungen.
Schlussfolgerung: Burnout-Diagnosen werden seltener berichtet als erwartet. Betroffene haben häufig eine manifeste psychische Störung.
-
Archiv
- April 2021
- Januar 2021
- November 2020
- September 2020
- Juni 2020
- September 2019
- Mai 2019
- März 2019
- Februar 2019
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- August 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- Oktober 2010
- September 2010
- August 2010
- Juli 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
- März 2010
- Februar 2010
- Januar 2010
- Dezember 2009
- November 2009
- Oktober 2009
- September 2009
- August 2009
- Juli 2009
- Juni 2009
- Mai 2009
- April 2009
- März 2009
- Februar 2009
- Dezember 2008
- November 2008
- Oktober 2008
- September 2008
- August 2008
- Juli 2008
- Juni 2008
- Mai 2008
- April 2008
- März 2008
- Februar 2008
- Januar 2008
- Dezember 2007
- November 2007
- Oktober 2007
- September 2007
- August 2007
- Juli 2007
- Juni 2007
- Mai 2007
-
Meta